Regional, ökologisch nachhaltig und unabhängig von Großhandelsstrukturen….
Das war vor nunmehr 10 Jahren unser Traum von Hof und so entschlossen wir uns, den Hof komplett als „solidarische Landwirtschaft“ oder „community supportet agriculture“, CSA zu gründen. Wir nennen es „gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft“, weil eine Gemeinschaft von Menschen, für die der Hof Lebensmittel produziert, im Gegenzug die Produktion finanziert und die Abnahme auch aller krummen Möhren, geraden Gurken und kleinen Kartoffeln garantiert. Alles ohne Verpackungsmüll, ohne Verwerfen von Lebensmitteln und mit kurzen Transportwegen.
Das war und ist unsere „Dream-Farm“ – heute wird es anhand der ganzen schwierigen Ereignisse weltweit immer klarer, dass sich dringend etwas tun muss in der Landwirtschaft. Unser Traum-Hof wird zur Notwendigkeit angesichts der Krisen, die die Welt erschüttern.

Wo soll ich anfangen, wenn ich auf die vergangenen 2 Jahre zurückblicke? Ein riesiger Haufen aus sich überschlagenden Ereignissen, Katastrophen, wirren Reaktionen, menschlichem Leid, Verzweiflung und ungelösten Fragen drängt sich dabei in meinen Kopf. Ich kann es kaum sortieren und soweit ich das überblicken kann, geht es vielen Menschen derzeit so.
Chiroptera. Ein kleiner Flughund, besser bekannt als „Fledermaus“ – obwohl in der Biosystematik keine Maus, sondern ein „Flattertier“ – das einzige Säugetier, welches fliegen kann. Ich beginne meine Gedanken gerne mit der Betrachtung von Tieren. Und somit möchte ich auch diesem Text eine kurze Gedankenspielerei voranschicken. Fledertiere sind unglaubliche Wesen – sie orientieren sich mit Echoortung und hören in Frequenzen, die uns Menschen nicht zugänglich sind. Sie „sehen“ quasi mit ihren Ohren. Sie sind hochsozial und wärmen sich gegenseitig in kalten Winternächten. Die Muttertiere ziehen ihre Jungen gemeinsam auf in teilweise sehr großen Kolonien von bis zu 50 Tieren. Sie sind – entgegen den gängigen Dracula-Mythen – sehr friedlich und bis auf ein kurzes Zetern und Zähnezeigen bei Störung nicht besonders angriffslustig. Allein der Mensch hat diese kleinen Wundertiere, die mit ihren Händen fliegen können, oft missverstanden. Weil sie kopfüber hängen, wurde ihnen im Mittelalter nachgesagt, entgegen der natürlichen Ordnung mit dem Bösen im Bunde zu sein. Weil sie nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs sind, wurde ihnen unterstellt, sich dem Lichtvollen zu entziehen. Dabei sind sie Meister der Orientierung, sie können gespannte Drähte von weniger als einem Millimeter Dicke sicher umfliegen und fangen zielsicher hunderte kleiner Fliegen. Ein Nützling sozusagen. In anderen Kulturen gelten sie wegen ihrer erstaunlichen Eigenschaften als Glückstiere und wenn man in die Traum-Psychologie schaut, fordert das Flattertier auf, zwischen Licht und Schatten im eigenen Inneren zu unterscheiden. Ich finde, das passt hervorragend zur hochsozialen Lebensart dieses kleinen Flughundes. Sind Hunde nicht im Allgemeinen ein Symbol für Loyalität und Freundschaft? Und wenn Freundschaft nun auch noch ergänzt wird durch einen hervorragenden Orientierungssinn und die Fähigkeit, sich in die Lüfte zu erheben? Ich möchte diese Gedanken als Geleitwort stehen lassen, denn es geht auch in diesem Text um die Frage, wie wir freundlich, hochsozial und unbeirrt von Ängsten, Hass, Verstrickungen, Zuschreibungen und verborgener Agenda eine Welt gestalten können, in der jedes Wesen noch so klein, seinen Platz finden darf.
Mit der Fledermaus fing es an. Als Träger von Corona-Viren war sie kurzzeitig in aller Munde und dann traf uns die Wucht der Pandemie. Und was kam nicht alles auf! Ängste auf allen Seiten – vor dem Virus, vor der Regierung, vor der Isolation, vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, vor den Masken, vor der Impfung – Angst und nichts als Angst. Unsere Orientierung ging uns flöten und die Gesellschaft fing an, zu zerren und zu ziehen. Die einen wurden dahin gedrängt, die anderen dorthin und anstatt in einer Welt, die gerade kopfüber hängt, auszuharren und sachlich zu lösen, was uns überrollt hatte, ist das Ergebnis nun, dass es verbitterte Grabenkämpfe gibt. Wie schade. Und wie sehr lenkt es uns ab von dem, was daraus entstanden ist und weiteren Katastrophen den Weg bereitet hat. Wir haben gesehen, wie unser globales Wirtschaftssystem sehr verletzlich und fragil ist und dass die, die am ehesten „runterfallen“, die sind, die sowieso schon am wenigsten haben oder am härtesten arbeiten, während die, die viel haben, ihren Reichtum verdoppeln konnten. Irgendwie geht das immer, dass findige Materialisten herausbekommen, wie sie aus der Not Profit schlagen, während in den viel wichtigeren Arbeitsbereichen Lieferengpässe die Arbeit erschwerten. Handwerk und Landwirtschaft – da traf es die Menschen auf eine Art am härtesten, denn ihr Brotverdienst hängt am globalen Handel. Und dennoch trägt ihre Arbeit dazu bei, die wichtigsten Güter wie Nahrung und ein Dach über dem Kopf zu haben. Unsere Gier nach mehr – ach, wie viele Jahre schon bedauert – und nach immer mehr immer billiger, damit noch mehr…. hat dazu geführt, dass wir nicht mehr in direktem Produzieren und Verkaufen denken, sondern unsere Ressourcen billig einkaufen wollen, um dann ein Produkt herzustellen, welches nur den Verkäufer – aber nicht den Produzenten reichlich entlohnt. Was für eine wahnsinnige Welt.
Menschen, die selbständig etwas herstellen, selbständig arbeiten haben oft Freude daran, Dinge zu kreieren, etwas Schönes zu erschaffen und es dann weiterzugeben. Nur weil diese Menschen oft nicht so die Verkaufstypen sind, machen sie daraus kein ausbeuterisches System, sondern bleiben bei ihrem einfachen, oft hart erarbeiteten Geschäft. Das ist es oft, wenn Menschen ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht haben, und man hat sich schon lange mit den Bedingungen arrangiert und eben sein Auskommen gefunden. Hauptsache, ich arbeite, was mich glücklich macht. Auch für die kleinen Restaurantbesitzer gilt das, für alle kleinen Selbständigen und Kulturschaffenden. Während die einen ausharrten, wann es wieder Öffentlichkeit gäbe, warteten die anderen hibbelig, wann und ob die benötigten Arbeitsmaterialien geliefert würden. Diese „Lieferschwierigkeiten“ halten teilweise bis heute an, aber da es wieder reichlich Klopapier im Supermarkt gibt, ist das eigentlich kaum jemandem so wirklich bewusst – es sei denn man arbeitet selbständig. Unser „click and buy“- System braucht dingend eine Zeit des Überdenkens… Würde der Welt-Handel über Nacht plötzlich komplett zusammenbrechen, wäre unsere Welt vor eine Mega-Krise gestellt. Das allermeiste produzieren wir nicht mehr regional und selbst um regionale Produktion zu generieren, brauchen wir oft Importartikel und sei es nur in kleinen Teilen.
Und als sei das nicht genug, erwartete uns Corona-Gebeutelten anstatt eines Jahres von Aufschwung dann der Schlag in die tiefsten Tiefen der Magengrube. Fast wortwörtlich, denn Putins Krieg in der Ukraine betrifft die Kornkammer Europas, wie es so schön heißt und welche von dem Gelb in der ukrainischen Flagge symbolisiert wird. Was das bedeutet und wohin das noch führt, ist wie ich schätze, den meisten noch nicht klar, denn sonst wäre der Aufschrei gegen diesen Krieg noch viel lauter, als er bereits ist.

In der Ukraine findet man besonders fruchtbare Schwarzerde-Böden, sehr humusreich, kalkhaltig und somit extrem ertragreich. Durch trockene Sommer und kalte Winter wird organisches Material nicht mineralisiert und reichert sich als gewaltige Humusschicht an. Um einen Eindruck von der Fruchtbarkeit der Böden in der Ukraine zu bekommen: im deutschlandweit angewandten System von Bodenbeurteilung mit Bodenpunkten hat fast die gesamte Fläche der Ukraine Bodenpunkte von 80 – 100. Unser ertragreiches Süddeutschland „nur“ 50 – 80, hier im Norden bei uns arbeiten wir mit Flächen von 20 – 30 Bodenpunkten. Der Boden von fast der gesamten Ukraine ist also knapp mehr als dreimal so „produktiv“ wie der Boden unseres Hofes. Dieser Boden bringt also auch ungefähr die drei- wenn nicht vierfache Ernte hervor, die als Kornkammer mittlerweile die gesamte Welt ernährt. Und auf diesem Boden liegen nun Granatsplitter, Trümmerteile von Kriegsgerät und Mienen.
Wie ist nun die Situation der Bauern in der Ukraine? Etwas weniger als die Hälfte des Landes wird von Kleinbauern, Familienbetrieben und selbständigen Bauern für den Binnenmarkt bewirtschaftet, wie Olena Borodina vom Ukrainian Rural Development Network berichtet. Diese Bauern leben allerdings in einer nochmal ganz anderen Situation als Bauern in Deutschland, denn sie erwartet keine Rente, sie erhalten keine staatlichen Hilfen in Form von Subventionen oder anderen Fördergeldern. Sie arbeiten traditionell geprägt, haben kaum Geld für Investitionen, was sich in der Qualität der Arbeitsmaterialien und der Zukaufsmöglichkeit von Betriebsmitteln niederschlägt. Dennoch erlauben ihnen die fruchtbaren Böden für lokale Märkte zu produzieren: Milch, Fleisch, Obst und Brot. Wie wir wissen, sind die Preise für Lebensmittel in östlicheren Ländern andere als in Deutschland, wo Lebensmittel sowieso schon oft unter Wert verkauft werden. (siehe: Was unsere Lebensmittel tatsächlich kosten) Im benachbarten Rumänien bekommen schafhaltende Betriebe in schlechten Jahren ungefähr 2 € pro Kilo Lammfleisch. Bei einem reinen Ertrag von ca. 9 Kilo Fleisch pro Tier kann man sich vorstellen, wie es um das Einkommen der Menschen bestellt ist. (Diese „günstigen“ Produkte sind übrigens der Anfang vom globalen Welthandel – dazu später mehr)
Dennoch können die kleinen ukrainischen Bauern sich glücklich schätzen, dass sie noch existieren, denn durch die erzwungene Kolchosenwirtschaft in Zeiten der Sowjetunion wurde viel Leid über die Bauern gebracht. Sie wurden gezwungen, ihre Ländereien aufzugeben, wogegen die Bauern natürlich protestierten, denn wer gibt schon freiwillig sein Land her, was Generationen der Familie bewirtschaftet haben? Die Kolchosewirtschaft war schwach, die Ernte ging um 20% zurück, Einzelbauern leisteten Widerstand. Um diesen endgültig zu brechen, begannen Stalins Requisitionstruppen, Getreide gewaltsam abzutransportieren. Kurz gesagt: ernährt werden sollten die Arbeiter und die, die die Industrialisierung vorantrieben, die Knappheit der Lebensmittel durch Missernten in 1931/32 sollte genutzt werden, um nun endlich auch den letzten Widerstand der Bauern beizulegen. Die Folge dessen war der Holodomor, der große Hunger in der Ukraine in den 1930er Jahren. Menschen verhungerten auf den Straßen, wenn man zu den Hungertoten noch die Geburtenverluste, die Opfer der Kollektivierung usw. zusammenfasst, kommen wir auf geschätzt ca. 14 Mio Menschen. Es muss eine Zeit der Hölle gewesen sein. Bauern wurden von den bolschewistischen Truppen von ihren Höfen vertrieben, Dörfer wurden geplündert, Menschen starben in den Straßen, ohne dass jemand sie wegräumte, in der verzweifelten Bevölkerung kam es zu Kannibalismus. Allein 9 Millionen dieser Opfer waren Bauern. Die verbliebenen, in die Kolchosen gezwungenen Bauern arbeiteten fortan wie Sklaven: sie bekamen keine Entlohnung, nur in Form von Lebensmittelrationen, ihnen wurden die Pässe abgenommen, sie durften ihre Dörfer nicht verlassen und rund um die Dörfer waren militärische Stützpunkte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende der Kolchosenwirtschaft sank die Produktion um 70%. Einzelne Bauern bekamen ein wenig Land zugewiesen, ungefähr 4 ha pro Person. Zum Vergleich: unsere landwirtschaftliche Produktionsfläche des WeidenHofs beträgt 36 ha und wir sind ein winziger Hof in heutigen Relationen. Dennoch konnten die ukrainischen Bauern den Produktionseinbruch nach und nach kompensieren, da sie beständig arbeiteten und guten Boden zur Verfügung hatten. Und genau auf diesem Boden hatten es dann größere Agrarholdings abgesehen. Es kamen ausländische Investoren aus Europa, ja aus der ganzen Welt, um für den Weltmarkt zu produzieren.
Fruchtbarer Boden und niedrige Preise für das Einzelprodukt. Ab den 2000er Jahren setzten sich große Agrarunternehmen mit 2000 ha und mehr fest. Dass kleine Bauern mit ein paar Hektar Land nicht konkurrenzfähig sind zu einflussreichen Agrarunternehmen mit Investitionskapital, Macht und den benötigten Netzwerken des globalen Handels, versteht sich von selbst. Interessanterweise arbeiten ukrainische Agrar-Studenten und Auszubildende nicht als selbständige Bauern, denn die Arbeitsbedingungen sind einfach zu schlecht. Sie hoffen eher auf einen Job in diesen Unternehmen. Das System von „wachsen oder weichen“ bekommt dort nochmal eine ganz andere, existenzielle Komponente. Und die Agrarunternehmen machen ein lukratives Geschäft, indem sie zu den weltweit größten Exporteuren gewachsen sind. Das Problem ist nur, dass sie neben den reichen Ländern, die mit Getreide, Hühnerfutterkomponenten, Sonnenblumenöl beliefert werden, auch ärmere Länder beliefern, wobei dort das Getreide für die menschliche Ernährung gedacht ist. Durch die durch den Krieg steigenden Preise der Agrarprodukte, die ja nun nicht mehr so einfach verfügbar sind – weil, anstatt den Acker zu bestellen, der Acker von Mienen geräumt werden müsste – kommt es nun dazu, dass gerade ärmere Länder sich das Getreide schlechter leisten können, bzw. es überhaupt nicht zur Verfügung steht. Eines der Länder, welches seine gesamten Weizenimporte aus der Ukraine bezieht, ist zum Beispiel Somalia. Obendrauf kommt, dass gerade die Infrastruktur und die Zentren der Agrarholdings, die für den Export arbeiten, zerstört sind. 4 Millionen ha werden offiziellen Angaben nach durch Großunternehmen bewirtschaftet, real sollen es mehr sein. 4 Millionen ha, die nun nicht mehr bestellt werden, auf denen kein Anbau zu erwarten ist, von denen kein Export stattfinden wird.
Der WeidenHof bewirtschaftet von seinen 36 ha Gesamtfläche 5 ha mit Gemüse und kann davon über 200 Ernteanteile generieren, also ca. 400 Menschen mit Gemüse versorgen. Was können 4 Millionen ha fruchtbarster ukrainischer Schwarzerde?
Wie Marita Wiggerthale von Oxfam berichtet, beziehen 36 Länder der Welt mehr als 50% ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. Auf dem Weltmarkt ist dieses Getreide für reiche Länder „billig“ – es wird für die Produktion eingekauft, die selbst zum Export gedacht ist. Oder für die Produktion, in der es Rohstoff ist – als Futtergrundlage für veredelte Produkte wie Fleisch oder Eier. Für ärmere Länder ist es notwendige Lebensgrundlage für Menschen – Brot für Frauen, Männer und Kinder. Die geringere Verfügbarkeit des Getreides treibt nun die Preise in die Höhe und wir spüren das daran, dass „Folgeprodukte“ teurer werden. vor allem geflügel- oder schweinehaltende Betriebe sind von importiertem Getreide abhängig, Futterkosten steigen und somit auch die entsprechenden Einzelprodukte im Preis für den Endverbraucher. Eiweiß – und Energiequellen, die zur Tierernährung notwendig sind, sowie Düngemittel werden rar, allerdings geht es hierzulande hauptsächlich um die Diskussion der vielschichtig verursachten Preissteigerungen. Für ärmere Länder wird es zur existenziellen Krise. Bereits heute hungern ca. 811 Millionen Menschen weltweit, trotz guter Ernten und gefüllter Getreidespeicher – aufgrund unseres globalen Wirtschaftssystems mit Import/Export, das fest mit der Produktion verknüpft ist und durch dieses komplexe Preisgestaltungssystem Einfluss auf die Leistbarkeit für schlechter gestellte Länder hat. In Somalia, welches komplett von der Ukraine abhängig ist, besteht bereits eine Hungerkrise durch den Klimawandel und seine Auswirkungen.
Trübe wird es vor dem inneren Auge und ich will die Nachrichtenbilder der kommenden Monate gar nicht sehen. Wie gerne schaue ich doch das liebe Flattertier an, von dem ich eingangs sprach. In Studien hat man herausgefunden, dass die Sozialität der Fledermäuse nicht nur darin besteht, dass sie zusammen in Höhlen „abhängen“ und ihre Kinder gemeinsam aufziehen. Fledermäuse pflegen lebenslange Freundschaften und wenn eines der Mitglieder der Gemeinschaft nicht genug zu fressen jagen konnte, würgen die Mitbewohner, auch wenn sie nicht verwandt sind, etwas hervor, um den Hungernden zu füttern. Dieses Verhalten ist angeboren scheinbar, denn in Versuchen zeigte sich, dass wenn eine Fledermaus nicht ausreichend mit Nahrung versorgt war, sie von ihren Artgenossen unabhängig von Verwandtschaftsgrad oder Status gefüttert wurde, egal welche Fledermaus man in der Nacht vom Jagen abgehalten hatte. Wurden diese Fledermäuse aus der Gefangenschaft entlassen, konnte belegt werden, dass die Freundschaften, die durch diese Unterstützung entstanden waren, beständig blieben. Ebenso scheint soziales Verhalten bei ihnen selbstverstärkend zu sein: wer andere am häufigsten fütterte, wurde auch selbst am häufigsten gefüttert. Dazu fällt mir dieses Märchen ein, in dem ein paar Leute an einem Tisch um einen Suppentopf sitzen, aber alle haben viel zu lange Löffel, mit denen sie selbst ihre Suppe nicht löffeln können, denn der Stiel des Löffels ist zu lang, um damit Suppe zu essen. Sie fangen an zu streiten und sich die Löffel um die Ohren zu hauen, bis jemand auf die Idee kam, dass doch jeweils einer den jeweils nächsten mit seinem Löffel füttern könnte und so wurden alle satt. Die Idee muss von einer Fledermaus gekommen sein.
Was können wir tun angesichts von über 800 Millionen hungernden Menschen, mit 30 % der Weltbevölkerung, die sich trotz guter weltweiter Produktion keine gesunden Lebensmittel leisten kann, während täglich 10 t Weizen verbrannt werden, Agrarkraftstoffe aus pflanzlichen Ölen gewonnen werden, Lebensmittel zu 75 kg pro Kopf und Jahr in Deutschland einfach weggeschmissen werden und oft ca. 50% der Produktion bereits vor dem Eintritt in die Handelskette „verworfen“ wird, da es nicht der handelsüblichen Norm entspricht? Während unsere Gurke eine „Normkrümmung“ haben muss, die Möhre nicht beinig sein darf, die Kartoffel nur ab einer bestimmten Größe im Kartoffelsack landet, lebt die Hälfte der Weltbevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Extreme Armut und soziale Ungleichheit sind immer die Ursachen für Hunger und der weltweite Hunger wird durch den Krieg in der Ukraine stiegen, durch Verfügbarkeit des Getreides und dessen Preis, von dem lediglich die Nahrungsmittelkonzerne profitieren, da sie auf die steigenden Preise an der Börse setzen. Oft werden durch die verschiedensten Krisen der aktuellen Zeit die Reichen nur reicher und die Armen…. verhungern schlimmstenfalls.
Wir haben ein konzerndominiertes Ernährungssystem, welches hochkomplex und kaum zu durchbrechen im globalen Handelssystem gefestigt ist. Die Abhängigkeit von Importen, die von den Konzernen und der industriellen Produktion von Nahrungsmitteln erschaffenen internationalen Warenströme, in deren reißenden Fluss man sich begeben muss, sind derartig vernetzt und unverzichtbar, da in Folge dieser ausgeklügelten Warenströme das einzelne Produkt für den Erzeuger kaum noch den Wert erbringt, den die Produktion benötigt, würde sie regional erfolgen. Der Weizen aus der Ukraine als Rohstoff ist für uns billig, weil Agrarholdings auf Masse produzieren mit enorm viel Fläche und weil die Löhne der Angestellten im Vergleich zu Deutschland sehr gering sind. Billige Rohstoffe sind aber wichtig in einem Produktionssystem, in dem Lebensmittelpreise des Großhandels oder der Discounter nicht die Kosten der Produktion decken können. Krisen und Mangel treiben den Preis für Rohstoffe in die Höhe, die zwar aus aller Welt kommen, aber ohne die auch ein kleinbäuerlicher Betrieb in Deutschland kaum noch produzieren kann. Was für den Betrieb der günstige Rohstoff ist, der importiert wird, ist für den Handel der günstige Rohstoff, der von den landwirtschaftlichen Betrieben in Form von Gemüse, Eiern, Milch und Fleisch eingekauft oder „importiert“ wird und in den Supermarktregalen landet. Kleinbauern sind auch nur ein Rädchen im Getriebe.
Was es braucht, ist eine Art radikalen Ausstieg aus diesem System. Ein Bruch mit Großhandelsstrukturen, indem die Produkte wieder auf lokalen Märkten direkt an den Endverbraucher abgegeben werden. So kommt beim Bauer das an, was die Lebensmittel kosten und nicht nur ein kleiner Teil davon. Ein Bruch mit Importen von Rohstoffen, sowie regionale Eiweiß- und Stickstoffversorgung für Tier und Pflanze. Wobei sich das noch am schwierigsten gestaltet. Hierfür müssen regionale Wirtschaftskreisläufe geschlossen werden, wobei aber entweder die Qualität oder der Preis die Produktion maßgeblich beeinflussen.
Zwei Beispiele dafür von unserem Hof:
Hühner. Wir halten Coffee und Cream Hühner von der ÖTZ (mehr dazu hier: Coffee und Cream bitte). Die Problematiken in der Hühnerwelt sind mittlerweile allen bekannt: Legehybriden, die am Ende der Legeperiode ausgezehrt sind, Kükenschreddern, heute ersetzt durch fadenscheinige Geschlechtsbestimmung im Ei, Massenställe. Hühner sind durch drei Faktoren massiv mit dem Konzernwesen verknüpft: das sind 1. Genetik, die Legeleistung oder Mastleistung generiert, 2. Hühnerfutter und 3. Eierpreis, bzw. Fleischpreis. Durch jahrzehntelange Züchtung kann man heute mit Legehybriden (die auch in der ökologischen Landwirtschaft gehalten werden) so viele Eier produzieren, dass es ein massenhaftes Angebot von Eiern gibt, was den Preis für ein einzelnes Ei derart drückt, dass es nur noch möglich wird, mit den entsprechenden Genetiken zu arbeiten, allerdings auch nur mit dem günstigen Import von Hühnerfutter, da ein solches Huhn mit einer derartigen Produktion auch entsprechend Energie und Eiweiß braucht, um nicht aus den Körperreserven heraus Eier legen zu müssen. Der nötige Eierpreis, um ein Huhn ein gemächliches Hühnerleben leben zu lassen, liegt sechs oder siebenmal über dem, was heutzutage von Verbrauchern für Eier verlangt werden kann. Eine Sackgasse, aus der wir so schnell nicht herauskommen werden. Zudem gibt es kaum regionale Futtermittelproduktion mehr, denn Futter für Tiere anzubauen ist unter den hiesigen Bedingungen viel zu teuer – dann müsste man noch mehr für ein einzelnes Ei bezahlen. Die Krux ist, dass Monogastrier wie Hühner damit in Nahrungskonkurrenz zum Menschen stehen. Sie werden vom Gras allein nicht satt, auch in der Freilandhaltung. Die Coffeehühner, die wir halten, legen genetisch bedingt nicht ganz so viele Eier, dafür sind sie am Ende der Legeperiode noch ein schönes, schweres Suppenhuhn. Das ist ein Anfang, wenn man hin zu mehr Regionalität will, denn nun wird durch Zweinutzung (Eier UND Fleisch) die Monopolisierung der Konzerne wieder ein Stückweit aufgehoben. Die Henne bringt also nicht nur Geld durch die Eier, sondern auch durch den Verkauf von Suppenfleisch. Gleichzeitig muss das Huhn aber wieder „geländegängiger“ werden, damit es sich auch draußen im Freiland etwas Zubrot sucht. Und das ist langjährige harte Zuchtarbeit. Dadurch, dass die Hühner an sich etwa doppelt so schwer sind, wie Legehybriden, brauchen sie auch mehr Futter für ihren Grundumsatz, dass heißt Energie, um ihren Körper zu erhalten, wovon sie noch kein Ei gelegt haben. Somit bleibt das Problem des Hühnerfutters und auch wir sind auf Hühnerfutter angewiesen, was nicht exorbitant teuer ist, um unsere Hühnerhaltung mit Zweinutzungshühnern zu finanzieren. Zumal durch dieses konzernbasierte System gar keine regionalen Produzenten mehr existieren, die mir regionales Hühnerfutter liefern könnten. Die Coffeehennen sind also revolutionär, aber bis ein System geschaffen ist, welches vom Grundsatz konsequent nachhaltig ist, wird es noch Jahre dauern. Um dahin zu kommen braucht es Betriebe, die es sich leisten können oder sich trauen, diese Rasse in der Praxis zu testen und Rückmeldung an die ökologische Tierzucht zu geben, die daraufhin weiterzüchten kann. Langfristig soll dieses Huhn in der Zweinutzung (Eier und Fleisch) wirtschaftlich sein, gut geeignet für die Freilandhaltung, um natürliche Ressourcen wie Weide, Gemüsereste oder auch Agroforstsysteme sinnvoll nutzen zu können und so robust und genügsam, dass es mit minderwertigeren, regional gut produzierbaren Energie- und Eiweißquellen leistungsstark bleibt.
Wollpellets. Mittlerweile düngen wir unser gesamtes Gemüse mit Wollpellets. Die Wolle dafür kommt von „nebenan“, unter anderem aus einer Schnuckenherde von einem befreundeten Kollegen, der in der Lüneburger Heide durch Hütearbeit Landschaftspflege betreibt und somit noch einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leistet. Diese Wolle wird lokal zu Pellets gepresst und dann zu uns geliefert. Im Vergleich zu handelsüblichem Dünger enthalten Wollpellets zwischen 9 und 11% Stickstoff. Handelsüblicher Dünger enthält knappe 30% Stickstoff, bzw. fast 50%. Nun ist Düngen ein komlexes Thema und es geht nicht nur um Stickstoff, sondern ebenso um viele andere Inhaltsstoffe, die Pflanzen auch brauchen, um gesund zu wachsen. Dazu kommt, dass jede Pflanze einen anderen Nährstoffbedarf hat und jede Bewirtschaftungsform, sowie jede Bodengrundlage andere Bedingungen schafft. Es gibt also nicht nur den einen Weg zu düngen, aber in den Mengen, die man auf landwirtschaftliche Flächen ausbringen muss, um auch ernten zu können, wird dann der Kilopreis für Stickstoff interessant. Um unser Gemüse ausreichend zu düngen, brauchen wir etliche Kilos Wollpellets im Jahr. Umgerechnet auf das Kilo Stickstoff kosten uns die Wollpellets ungefähr das zehnfache im Gegensatz zu dem, was man früher für ein Kilo Stickstoff bezahlt hat. Teuer. Aber nur, wenn man in industriellen Produktionsvorgaben denkt und sich damit der Diktatur der konzernorientierten Nahrungsmittelproduktion beugt. Auch das verändert sich krisenbedingt aktuell, denn die Düngemittelpreise gehen in die Höhe – auch die einzelnen Komponenten der Düngemittel unterliegen dem konzernbasierten Welthandelssystem, während die Wolle von nebenan üblicherweise verworfen wird. Aktuell sind die Wollpellets im Vergleich zu konventionellen Düngemitteln „nur noch“ fünfmal so teuer. Globale Krisen haben Auswirkungen in vielen Bereichen, die der Öffentlichkeit nicht immer bewusst sind. Unsere lokalen Wollpellets sind preisstabil. Der Wert in kleinbäuerlicher, lokaler Produktion und dem Schließen regionaler Wirtschaftskreisläufe zeigt sich im Entstehen von Ernährungssouveränität. Und diese ist eigentlich unbezahlbar, denn sie ist Teil der Auflösung der globalen Nahrungsmittelkrise.
Coffeehennen und Wollpellets werden den Welthunger nicht stillen, dies sind lediglich zwei Beispiele, wie wir als landwirtschaftliche Akteure gemeinsam neue Systeme entwickeln können, die weltweit für einen gerechten und ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln sorgen können. Ein landwirtschaftlicher Betrieb – gerade ein kleinbäuerlicher Gemischtbetrieb hat einen enormen Bedarf an unterschiedlichen Betriebsmitteln, ohne die eine Produktion, die den Betrieb finanzieren kann, nicht möglich wäre. Von daher ist es umso wichtiger, dass Erzeuger und Verbraucher wieder in direktem Kontakt stehen. Durch die Abnahme aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse – auch der krummen Gurken und beinigen Möhren – und die Vollfinanzierung der landwirtschaftlichen Produktion wird es für den Bauern erst denkbar, erste Schritte in Richtung regionaler Wertschöpfungsketten zu gehen und etwas zu wagen wie: „unproduktive“ Coffeehennen halten und das Gemüse mit „teuren“ Wollpellets zu düngen. Von diesen kleinen Zentren aus, die heute zum Bespiel als solidarische Landwirtschaft wirtschaften kann Ernährungssouveränität verstärkt werden und das weltweit. Mit der Folge, dass lokale Bauern die lokale Bevölkerung – überall auf der Welt – ernähren können. Lebensmittelproduktion wird resilienter gegenüber weltweiten Krisen und die Abhängigkeit von fragilen Lieferketten wird verringert. In diesem Sinne bedeutet jede lokale solidarische Landwirtschaft auch Solidarität mit allen Bauern weltweit.
Hier in Deutschland, wie im gesamten Westeuropa geht es momentan hauptsächlich darum, dass wir uns eine ökologischere Landwirtschaft wünschen. Eine, die dem Tierwohl Rechnung trägt, die ressourcenschonend wirtschaftet, die die Natur nicht ausbeutet und Artenvielfalt schützt und eine, die gesunde Lebensmittel erzeugt. Als Randthemen gibt es noch die Lebensmittelverschwendung und den Verpackungsmüll, aber das hängt nicht nur allein am Landwirt, sondern auch am Handel und am Endverbraucher selbst. Anstatt der allgegenwärtigen Plastikverpackungen gibt es mittlerweile „unverpackt“-Läden, in denen man sich Trockenprodukte abfüllen lassen kann in selbst mitgebrachte Behältnisse. Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, welches Handel und Endverbraucher gleichermaßen betrifft. Wir Landwirte können beginnen, anders zu wirtschaften, aber wie oben dargelegt, stellen sich Hürden auf, entweder in den Kosten der Produktion, die über den Preis des Produkts wieder reingeholt werden müssen oder in der Verfügbarkeit von qualitativ angemessenen Rohstoffen um konkurrenzfähige Produkte herzustellen, in Menge und Qualität. Sind diese Rohstoffe verfügbar, müssen sie auch bezahlbar sein, wie am Beispiel der Wollpellets deutlich wurde. Hier ist solidarische Landwirtschaft eine enorme Chance, diese regionalen Wirtschaftskreisläufe zu schließen.

Betriebswirtschaft ist mir ja immer ein Rätsel und wird es immer bleiben. Es scheint etwas zu sein, was diese Finanzfuzzis sich ausgedacht haben. Da ich keine Direktkostenrechnungen machen muss, sondern die Finanzierung der Produktion unseres Hofes über die Mitgliedsbeiträge der solidarischen Landwirtschaft gesichert ist, stellt sich unser Haushaltsetat ganz anders dar. Wir haben die Möglichkeiten, betriebswirtschaftliche Vernetzungen zwischen den einzelnen Betriebszweigen herzustellen, die sich dadurch gegenseitig absichern. Verrückt – aber dadurch, dass wir solidarische Landwirtschaft machen und anders rechnen können, machen wir seit 10 Jahren die Erfahrung, dass dieses kostendeckende Arbeitssystem extrem stabil bleibt. Und was haben wir schon für hofinterne Krisen durchgestanden! Jede dieser Krisen hat zu Verbesserungen geführt. Mittlerweile gibt es drei „große“ Produktionsbereiche – Gemüse, Eier, Fleisch – die sich gegenseitig stützen. Und dabei sind wir auch arbeitswirtschaftlich immer stärker in Vernetzung gekommen. Das Resultat ist ein Hof, auf dem Tierwohl leistbar wird, auf dem Lebensmittel nicht mehr verworfen werden – selbst die allerkleinsten Möhrchen, die nun wirklich nicht mehr ins Depot für die Mitglieder können, landen bei den Hühnern oder Schafen und werden dort verwertet. Die Hühner und Schafe produzieren fleißig Mist, der dann ins Gemüse wandert, nachdem er den Kompostierungsprozess durchlaufen ist. In diesem Sinne ist die Verwendung der Wollpellets vom Schäfer nebenan quasi nur eine Erweiterung des Hofkreislaufes und bildet ein regionales Netzwerk. Ein Problem ist und bleibt das Hühnerfutter, aber daran können wir vorerst nichts ändern, wenn es nicht von außerhalb noch stärkere Bestrebungen zu regionalen Wirtschaftskreisläufen gibt. Anstatt Masthuhnanlagen mit hunderttausenden Tieren oder ähnlich konzipierte Schweinemast und Maisanbau könnte ich mir gut vorstellen, regionalen Leguminosenanbau oder Experimente mit energiereichem Getreide zu fördern – dann könnten auch in diesem Bereich neue Wege in der Hühnerfütterung in kleinbäuerlichen Haltungsformen beschritten werden. Genauso kämen wir nämlich zu dem, was Ernährungssouveränität in ihrer Gänze bedeuten würde. Wenn ich letztlich alle Komponenten meiner Futtermittel und Düngemittel aus der Region oder zumindest von nicht so weit weg beziehen könnte. Solidarische Landwirtschaft wie wir sie betreiben, ist ein erster kleiner Schritt in Richtung Ernährungssouveränität. Für den großen Schritt brauchen wir alle – Verbraucher, die Teil einer gerechteren Welt werden wollen und Landwirte, die wieder kleinbäuerlich und diversifiziert arbeiten wollen und sich das auch leisten können, weil es bezahlbare und resiliente regionale Warenströme und Wertschöpfungsketten gibt.
Für andere Länder der Welt, deren Lebensstandard nicht so hoch ist, würde das auch bedeuten, die regional hergestellten Produkte wieder vermehrt für den eigenen Gebrauch nutzen zu können, da sie nicht für unsere Produktion exportiert werden. Überschüsse könnten immer noch an Länder in Krisensituationen abgegeben werden, bis auch diese sich aufgrund heimischer Wirtschaftskreisläufe stabilisieren können. Ernährungssouveränität regional bedeutet Ernährungssouveränität weltweit!
Die gesamte Agrarlandschaft könnte sich erholen, anstatt riesiger hektarstarker Farmen gäbe es ein klein gegliedertes Netz von Familienunternehmen, die oftmals durch ihre kleineren Flächenstrukturen und dazwischen befindlichen Landschaftselemente wie Hecken und Baumsäume gleichfalls Ruhezonen für Wildtiere und Raum für Wildkräuter bieten. Dann wäre erreicht, was wir heute unter Agrarökologie verstehen. Um dieses Wort mit Inhalt zu füllen: Agrarökologie bedeutet eine bäuerliche Agri-Kultur, mit Vielfalt über und unter der Erde. Bedeutet Kontrolle über die Lebensgrundlagen durch weniger Abhängigkeit und mehr Autonomie. Autonomie heißt auch Selbstregulationsfähigkeit, Diversifizierung und Resilienz, wodurch lokale Märkte gestärkt werden. Letztlich ist das nicht nur ein System, welches der Natur und der Landwirtschaft mit ihren Pflanzen und Tieren gut tut, sondern auch den Menschen, die darin leben: Durch lokale Produktion sind wir wieder im direkten Kontakt, Solidarökonomien können gestärkt werden, denn solidarisch zu sein ist kein Gefühl, sondern ein konkretes Miteinander. Solidarität beginnt dort, wo aktiv etwas getan wird, um an den strukturellen Ursachen von Problemen zu arbeiten und diese zu beseitigen. Solidarökonomie bedeutet also nicht, durch Hilfslieferungen die Symptome von Hunger zu bedecken, sondern das Wirtschaftssystem so umzubauen, dass die Ursachen von Hunger und Umweltzerstörung beseitigt werden und durch einen gemeinsamen Prozess eine neue Form von Wirtschaftsorganisation geschaffen wird. Beteiligung und Mitsprache werden dadurch ermöglicht, Gleichberechtigung wird gestärkt und aus den Erfahrungen aus dieser stabilen, menschlichen Wirtschaftsweise würden förderliche Politiken abgeleitet, Forschung partizipativ für ein gleichgewichtsorientiertes Wirtschaften ermöglicht…etc…. Agrarökologie bringt Ernährungssouveränität und Ernährungssouveränität schafft Agrarökologie.
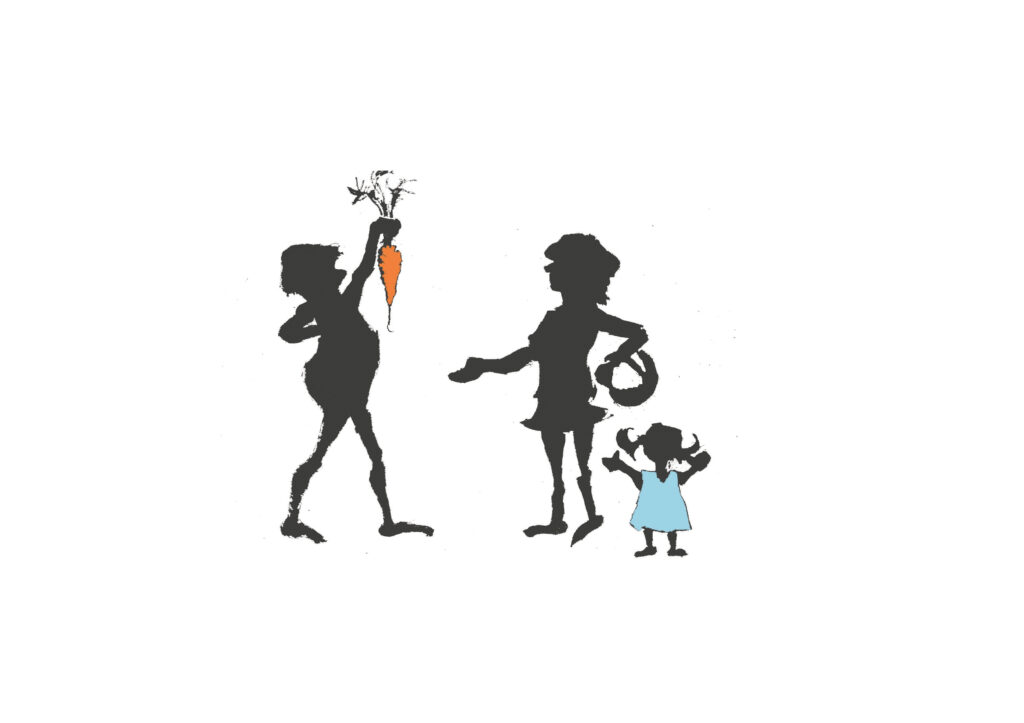
Ich muss aufhören, denn ich habe mich bereits auf den Schwingen von Chiroptera in eine Zukunftsutopie begeben und fliege hoch oben über tausenden von Wörtern auf einer Idee einer schöneren, gerechteren Welt, in der niemand angesichts gefüllter Getreidespeicher hungern muss und jedes Tier mit dem ihm gebührenden Respekt behandelt wird. Oder doch nicht so utopisch? Sollte es möglich sein? So ganz utopisch kann es ja nicht sein, denn wenn wir es geschafft haben, nun seit nunmehr 10 Jahren unsere „Dream-farm“ zu bauen, zu nähren und zu beleben, dann scheint es doch möglich, andere Wege zu gehen, egal, wo man den Anfang macht. Und vielleicht ist das ja „nur der Anfang“ – gut Ding will Weile haben. Vielleicht… wer weiß. Es gab ja noch dieses kleine Flattertier, welches uns auffordert, zwischen Licht und Schatten im eigenen Inneren zu unterscheiden. Orientieren wir uns doch an den anderen, leisen Dingen, die dem lärmenden industriellen Alltag fremd sind. Orientieren wir uns doch am inneren Licht, welches umso stärker leuchtet, umso mehr wir füreinander sorgen, unabhängig von Status oder Verwandtschaft, Nationalität oder Kapital. Dann wird für alle genug da sein, denn diese Welt ist voller Schätze und Schönheiten und kleiner Wunder.


















Barbara Meier 8. Mai 2022
Danke Anke für diesen guten Artikel!
Schaeferin 10. Mai 2022 — Autor der Seiten
gerne. 🙂
Conny Fiedler-Hellmann 1. Juni 2022
Hey Anke, danke für Deinen hervorragenden, umfassenden, mutmachenden Artikel!